Neuestes Buch:
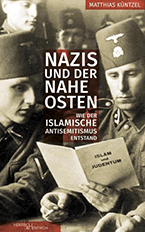
Nazis und der Nahe Osten
Wie der islamische Antisemitismus entstand
Über das Buch "Hamas - The Quest for Power" der Hamas-Experten Milton-Edwards und Farrell

Hamburg, 31.Oktober 2025
Im Juni 2024, acht Monate nach dem schlimmsten antijüdischen Massaker seit dem Holocaust, veröffentlichten Beverley Milton-Edwards und Stephen Farrell ihr Buch Hamas – The Quest for Power. Es handelt sich hierbei um eine überarbeitete und aktualisierte Version der Schrift Hamas: The Islamic Resistance Movement, die die Autoren 2010 veröffentlicht hatten.
Beverley Milton-Edwards war Professor of Politics at Queen’s University Belfast and ist Senior Non-Resident Fellow beim Middle East Council on Global Affairs, das seinen Sitz in Doha hat. Dessen Homepage weist sie als gelegentliche Beraterin des Außenministers von Katar aus. 1996 publizierte sie das Buch Islamic Politics in Palestine, das basierend auf Interviews mit 34 Palästinensern die Vorgeschichte und Geschichte der Hamas rekapituliert.
Stephen Farrell arbeitete als Nahost-Korrespondent für die New York Times und war bis 2022 Bürochef der Nachrichtenagentur Reuters in Jerusalem.
Wie schon die Milton-Edwards Studie von 1996 basiert auch diese jüngste Veröffentlichung auf Interviews mit Kadern und Sympathisanten der Hamas, darunter prominente Führer wie Mahmoud Zahar, Abdel Aziz Rantissi, Ismail Haniyeh, Ahmed Yassin, Khaled Meshaal und Yahya Sinwar.
„Der Zweck des Buches“, schreiben die Autoren, besteht darin, Einblicke zu geben, wie die Hamas entstanden ist, gewachsen ist und sich in den … palästinensischen Gebieten entwickelt hat. (X) Dieses Ziel wird im großen Ganzen erreicht. Allerdings bleiben äußere Einflussfaktoren, wie die enge Zusammenarbeit der Hamas weitgehend außen vor.
Die 15 Kapitel des Buches sind teils chronologisch, teils systematisch angeordnet. Kapitel 1 beginnt mit den dramatischen Ereignissen des 7. Oktober und den ersten Monaten des Gaza-Kriegs. In den nachfolgenden sechs Kapiteln wird die Entwicklung der Hamas und deren Vorgeschichte von den Dreißigerjahren bis zur jüngsten Vergangenheit nachgezeichnet.
Die sich anschließenden Kapitel 8-14 behandeln einzelne Phänomene wie zum Beispiel die Kultur des Märtyrertums, die Situation der Frauen, die Frage der Wahlbeteiligung und die Umwandlung des Gaza-Streifens in ein „Hamastan“. Im letzten Kapitel kommen die Autoren auf das Massaker des 7.Oktober 2023 zurück.
Die historischen Abschnitte des Buches beginnen mit der Vorbildrolle des salafistischen Predigers Izz ad-Din al-Qassam, der 1935 in der Nähe von Jenin getötet wurde. Sie informieren über die 1973 von Ahmed Yassin gegründete Vorläuferorganisation al-Mujamma‘ al-Islami (Das islamische Zentrum), die sich als Alternative zur PLO verstand und deshalb von Israel bis Anfang der Achtzigerjahre gefördert wurde.
Wir erfahren vom Ausbruch der Intifada Ende 1987 und der Gründung der islamistischen Hamas, die in ihren Anfängen weiterhin nicht Israel, sondern die säkulare PLO bekämpfte.
Dies änderte sich 1989, als die Hamas erstmals israelische Soldaten kidnappte und tötete. 1991 folgte die Gründung der Izz ad-Din al-Qassam Brigaden, des militärischen Flügels der Organisation.
Auf das 1993 von Israel und der PLO unterzeichnete Oslo-Abkommen reagierte die Hamas 1994 mit einer ersten Serie von Selbstmordattentaten in Israel, die das Ziel verfolgten, den Friedensprozess zu torpedieren. Dieser Terror der Hamas trug maßgeblich dazu bei, dass 1996 erstmals Benjamin Netanyahu Premierminister wurde.
Nachdem im Sommer 2000 der von Bill Clinton beförderte Camp David Friedensprozess an der Intransigenz Arafats gescheitert war, begann die zweite Intifada, in deren Verlauf die Hamas Hunderte Israelis durch Selbstmordattentate tötete. Wir erfahren schließlich, wie die Hamas nach dem 2005 erfolgten Rückzug Israels aus dem Gazastreifen im Folgejahr die palästinensische Parlamentswahl gewann und sich 2007 nach blutigen Kämpfen mit der Fatah die Alleinherrschaft über den Gaza-Streifen sicherte.
Terror gegen Andersdenkende – dieses Muster zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Hamas. So berichtet ein Zeitzeuge, dass schon die Anhänger von Sheikh Izz ad-Din Qassam, jeden, der schlecht über ihren Führer sprach, töten ließen (27). Über den Mujamma-Vorläufer der Hamas heißt es:
„Nach dem Freitagsgebet wurden brennende Fackeln hochgehalten, während Mujamma-Schläger Bibliotheken, Zeitungsredaktionen, Billardhallen und Bars in Brand setzten. Sie brannten Kinos und Cafés nieder, schlossen Spirituosengeschäfte und führten Einschüchterungskampagnen durch.“ (43)
Nach dem Oslo-Abkommen betrachtete die Hamas alle Unterstützer dieser Friedensregelung als Kollaborateure, die den Tod verdienen:
„Die PA [Palästinensische Autonomiebehörde] erwies sich als unfähig, die Morde zu stoppen, und es tauchten Leichen von Palästinensern auf, die Spuren einer summarischen Hinrichtung aufwiesen.“(69)
Nicht minder zimperlich ging die Hamas nach ihrer Machtergreifung im Gaza-Streifen mit Fatah-Anhängern um: „Bei einer Kundgebung der Fatah zum Gedenken an den Tod von Yasser Arafat im November 2007 töteten Hamas-Kräfte sechs Menschen und verletzten 100 weitere.“(202)
Besonders schlimm traf und trifft es die Mädchen und Frauen.
„Gangs von Hamas-Vollstreckern stürmten in Klassenzimmer und forderten, dass Mädchen ohne Kopftuch einen Hijab tragen sollten. … Wann immer sie eine Frau ohne Schleier sahen, griffen sie sie an und warfen ihr manchmal Säure ins Gesicht. … Bald darauf wurden Frauen ohne Kopftuch auf der Straße gesteinigt und misshandelt; ihr moralisches und nationales Engagement wurde offen in Frage gestellt.“(150)
Terror also, wohin das Auge blickt. Die Autoren berichten darüber, schrecken aber davor zurück, die Dinge beim Namen zu nennen: Die Worte „Terror“ oder „Terrorismus“ kommen bei ihnen nicht vor. Sie versuchen stattdessen, das gewaltsame das Agieren der Hamas mit angeblich edlen Motiven dieser Organisation in eine Verbindung zu bringen.
Sie behaupten zum Beispiel, dass die Hamas mit dem Mittel der Gewalt „ihr politisches Ziel von Freiheit und Unabhängigkeit“ verwirklichen wolle. (XI) Die Frage, was in einer strengen Scharia-Gesellschaft unter „Freiheit“ zu verstehen und wie der hehre Freiheitsanspruch mit dem Massaker des 7. Oktober zu vereinbaren sei, wird nicht gestellt.
Stattdessen werden selbst die Qassam-Brigaden als „Freiheitskämpfer“ gefeiert, wenn es heißt, dass diese „mühelos ihr Engagement für die Sache und ihr Land – die Befreiung Palästinas – verbinden.“(108) In den Schlusssätzen des Buches verleihen die Autoren gar ihrer Hoffnung Ausdruck, dass „die grundliegenden Anliegen“ der Hamas den Benachteiligten in aller Welt als Ansporn dienen: „Die grundlegenden Anliegen, für die sich die Hamas einsetzte, hatten nach wie vor die Kraft, Unterstützung zu gewinnen und das palästinensische Volk sowie eine wachsende Zahl von Entrechteten im globalen Süden und Marginalisierten im Westen zu mobilisieren.“ (271)
Bei Sätzen dieser Art fühlt sich der Rezensent an die Parole Globalize the intifada! und an den Weltrevolutions-Jargon der Siebzigerjahre erinnert, als Teile der westlichen Linken einen Mao oder einen Pol Pot zum Vorbild kürten, ohne deren millionenfachen Morde mit in den Blick zu nehmen. Und in der Tat nehmen Milton-Edwards und Farrell auch die Besonderheiten des 7. Oktober – das sadistische Hinmetzeln hunderter unbewaffneter Zivilisten unter Allahu Akbar-Rufen – nicht wirklich in den Blick.
Dass diese lebendigen Leibes verbrannt, geköpft, gequält und vergewaltigt wurden, hat bei ihnen keine Erschütterung, ja nicht einmal ein Innehalten ausgelöst. Sie sehen in der Tötung der 1.200 Israelis lediglich das „düstere und beständige Muster“ (95) von Gewalt und Gegengewalt am Werk, das seit Jahrzehnten den Konflikt bestimme.
Sie nehmen zu dem Massaker als Hamas-Experten keine Stellung, sondern üben sich in scheinbarer Äquidistanz: So werden kommentarlos Kritiker des Massakers wie auch die Rechtfertigungsreden der Hamas zitiert. Im Fall des 7. Oktober bedeutet aber Äquidistanz Parteinahme für die Angreifer.
Und tatsächlich berichten Milton-Edwards und Farrell mit kaum gedämpftem Enthusiasmus über die zwei Jahre währenden Vorbereitungen und den vermeintlichen Erfolg des Massakers. Die Hamas habe bewiesen, so heißt es bei ihnen (IX), „dass sie über die strategische Fähigkeit verfügt, einer Militärmaschine, die sich als die beste im Nahen Osten bezeichnet, einen demütigenden Schlag zu versetzen.“ Der Angriff der Hamas habe „sicherlich ihr Profil geschärft und ihren Bekanntheitsgrad oder ihre Berühmtheit rasch und umfassend verbreitet.“ (263)
Damit haben beiden Autoren zwar die Pro-Hamas-Stimmung im westlichen akademischen Lager ziemlich genau getroffen. Doch der Preis dafür ist hoch. Ihre Haltung setzt voraus, dass reale Motive, die dem Angriff des 7. Oktober zugrunde lagen, zum Beispiel der Antisemitismus und die Djihad-Idee, ignoriert werden.
1996 noch hatte sich Beverley Milton-Edwards in ihrer oben genannten Monographie über mehrere Seiten hinweg mit dem Antisemitismus in der Charta der Hamas befasst. Diese Charta erwecke den Eindruck, schrieb sie damals auf Seite 189, als habe ihr Autor die Seiten der „Protokolle der Weisen von Zion“ offen aufgeschlagen neben sich liegen gehabt. Doch nach dem antijüdischen Massaker von 2023 wird der Antisemitismus dieser Charta auf gerade einmal 13 Zeilen abgehandelt, also faktisch ignoriert. (18)
An anderer Stelle zitieren die Autoren den Hamas-Führer Abdel Aziz Rantissi: „Im Namen Allahs, wir werden die Juden bekämpfen. … Bei Gott, wir werden auch nicht einen Juden in Palästina übriglassen. Wir werden sie mit der ganzen Kraft, die wir haben, bekämpfen.“ (10)
Zwar spricht Rantissi weder von Israelis noch von Zionisten, sondern von „Juden“. Zwar will er diese Juden nicht einmal als schutzbefohlene Menschen zweiter Klasse, wie im Frühislam üblich, akzeptieren. Zwar ist er entschlossen, den Nahen Osten nach dem Rezept der Nazis „judenfrei“ zu machen. Und doch wollen Milton-Edwards und Farrell hier keinen Fall von Antisemitismus sehen. Sie interpretieren Rantissis Äußerungen lediglich als den expliziten Ausdruck seines Wunsches, über palästinensiches Land zu verfügen. (10)
Desweiteren unterschätzen sie die Rolle der Religion. Am 7. Oktober zeugten die Rufe Allahu Akbar („Allah ist der Größte“), die die blutrünstig begangenen Verbrechen begleiteten, von der festen Überzeugung, dass das Massaker von Gott gewollt sei. Dies erklärt die Begeisterung der Mörder und das Triumphgeheul, das beim Abschlachten erklang.
Im Buch von Milton-Edwards und Farrell kommen diese Allahu Akbar-Rufe nicht vor. Über die Selbstmordattentate – d e m Kennzeichen der Hamas, wird zwar ausführlich berichtet – aber stets nur verständnisvoll, niemals kritisch. Milton-Edwards und Farrell präsentieren zum Beispiel den Fall der Palästinenserin Maryam Farahat, die unter dem Namen Umm Nidal (Mutter des Kampfes) berühmt wurde.
„Sie … war eine Volksheldin für die Hardliner der Hamas, nachdem sie drei ihrer Söhne als „Märtyrer“ für die Sache geopfert hatte. Sie wurde sogar mit ihrem jüngsten Sohn vor dessen Selbstmordmission, bei der er ums Leben kam, gefilmt, als sie ihm sagte, er solle nicht zu ihr zurückkehren, es sei denn, er sei ein Shaheed (Märtyrer).“ (156)
Hier wird, was eigentlich religiös motivierter, mörderischer Wahnsinn ist, als Widerstand rationalisiert.
Milton-Edwards und Farrell haben mit Hamas – The Quest for Power ein Buch geschrieben, dass zwar aufgrund der zahllosen Interviews mit Angehörigen der Hamas-Gründergeneration und deren Nachfolgern interessante Details präsentiert. Dabei ging jedoch die Distanz zum Untersuchungsgegenstand über weite Strecken verloren.
Im Ergebnis verbreitet das Buch die Hamas-Ideologie in einer für westliche Intellektuelle akzeptablen Form.
Hamas: The Quest for Power. By Beverley Milton-Edwards and Stephen Farrell. Cambridge UK:Polity Press, 2024. 332 pages. $ 58.00 (cloth).
Bild: Feier zum 25. Gründungstag der Hamas in Gaza, Dezember 2012 · Quelle: farsnews · Autor: Hadi Mohammad · Lizenz: CC BY 4.0